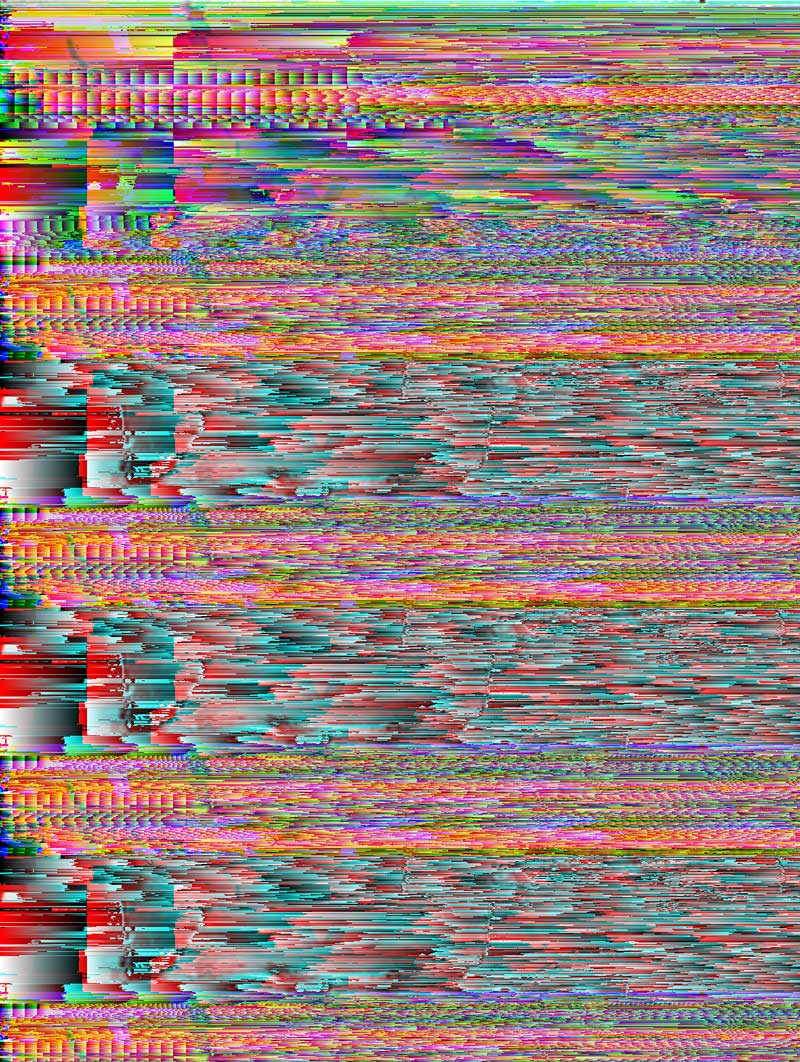Die Krise der Zeitlichkeit in der Popmusik
Über den Autor
Christoph Möller moderiert auf ByteFM die Musiksendung Popschutz und arbeitet als freier Autor für das öffentlich-rechtliche Radio. Sein Interesse gilt kosmischen Abenteuern und verlorenen Zukünften. Wenn er einen Ort nennen müsste, an dem er sich gerne aufhält, dann wäre es das Dazwischen.
Mittel • Essay 06.08.2016
„Gatsby glaubte (…) an die orgastische Zukunft, die Jahr für Jahr vor uns zurückweicht. Sie ist uns bisher versagt geblieben, aber das macht nichts: Morgen werden wir schneller rennen und unsere Arme weiter ausstrecken, bis eines schönen Tages –
So kämpfen wir uns voran wie Schiffe gegen die Strömung, unaufhörlich zurück ins Vergangene getrieben.“F. Scott Fitzgerald – "Der große Gatsby"
Zerhacktes Graffiti in Pink, Grün, Rot, flackernd wie eine Neonröhre, dann schwarz-weiße Fratzen; Formen, die aussehen, als hätte jemand zu lange mit dem Radiergummi aus Paint daran herumgefummelt.
Alles überlagert sich, beim Scrollen variiert die Musik.
Das Visuelle ist gerade konkret genug, um bekannte Formen zu erkennen – eine überdimensionale Spritze, ein Affenkopf, ein Smartphone? –, und gerade so unkonkret, dass wir nichts Menschliches damit assoziieren können. Informationen fehlen. Kunst aus dem Zwischenraum sozusagen. Allein der visuelle Eindruck reicht, um zu wissen, wie Amnesia Scanner klingen: Bohrende elektronische Klangflächen umschließen dumpfe Rumpel-Beats, Klangfetzen dröhnen durch die Luft. Musik, die eine bewusste Entscheidung erfordert, sie zu hören. Niemals würde ein Radio diese Musik spielen.
Every Song Ever heißt das aktuelle Buch des New-York-Times-Pop-Kritikers Ben Ratliff. Darin beschreibt er, wie wir Musik hören in einem Zeitalter, in dem jeder Song, der jemals aufgenommen worden ist, nur einen Klick entfernt ist. Wie also die unendliche Gleichzeitigkeit der Popmusik unseren Musikkonsum verändert. Ratliff beobachtet einen Lebensstil, den er „curatorial me“ nennt. Der sich selbst kuratierende Mensch erstellt Playlists, die einzig und allein als Persönlichkeitsverstärker dienen. Diese Playlists folgen – so Ratliffs These – keiner Tradition musikalischer Kontinuität, eine Aufteilung in Hoch- oder Subkultur falle weg; stattdessen suchen wir in der Möglichkeitswelt des music streams den perfekten individuellen Selbstausdruck. Ratliff ist Kulturoptimist. Er trauert keiner verlorenen Zeit nach, sondern schlägt vor, Musik nicht länger in Genres oder territorialen Zuschreibungen (Stichwort Weltmusik) zu beschreiben, sondern den Fokus einzig und allein auf den Sound zu legen. Dazu gehört eine qualitative Hörer*innen-Haltung – wir beginnen, das transzendent-achtsame Hören als Weg aus der Verlorenheit im digitalen Jetzt anzuerkennen. Doch nach wie vor überschütten uns hippe Radiosender, ausgeklügelte Algorithmen und Playlist-Kurator*innen mit neuer Musik. Sie schüren unsere Lust, alles mitzubekommen, was vermeintlich wichtig ist. Der Streamingdienst Deezer lockt uns mit 40 Millionen Songs im Angebot und 20.000 neuen jeden Tag. Dazu kommen neue Alben, die über Nacht ohne Ankündigung ins Netz gestellt werden: Kanye West, Beyoncé, Adele, Rihanna, Radiohead.
Der Kulturtheoretiker Mark Fisher diagnostiziert eine „gegenwärtige Krise kultureller Zeitlichkeit“. Ich glaube, dass die Popmusik als Seismograph atmosphärischer Verschiebungen diese Diagnose einerseits widerspiegelt. Und andererseits in einen konstruktiven Positivismus überführt. Das zeigen drei Strömungen der verdichteten Konzentration und der Verlangsamung – letztere meint hier auch eine Hörer*innen-Haltung: ein Zurücktreten aus dem Strom der Zeit, ein Bewundern der ineinanderfließenden Zeit.
1. Politisch inspirierte Verlangsamung
Die aktivistische Bewegung Black Lives Matter hat die Popmusik wieder politisiert. Insbesondere im Hip-Hop und der Black Music inszenieren sich Künstler*innen als politische Performer*innen. Alben wie How To Pimp A Butterfly von Kendrick Lamar, Freetown Sound von Blood Orange, Lemonade von Beyoncé oder HEAVN von Jamila Woods setzen sich – mit unterschiedlichen Formen und Haltungen – explizit mit Diskriminierung und Ausgrenzung auseinander. Die soundimmanenten und außermusikalischen Ereignisse dieser Alben erfordern ein hohes politisches und zeichentheoretisches Verständnis. Einfacher zu dekodieren ist die neue Protesthaftigkeit von Anohni, die auf ihrem Album Hopelessness zur Anklägerin einer kaputten Welt wird. Süß und lieblich singt Anohni über Todesstrafe, Vergewaltigung und Terror. Die Melodien sind betörend, die Inhalte grausam. Der Song „Drone Bomb Me“ erzählt aus der Sicht eines afghanischen Mädchens, deren Eltern bei einem amerikanischen Drohnenangriff ums Leben gekommen sind. Jetzt fleht das Mädchen voller Verzweiflung: Bitte bringt auch mich um! Anohni entwickelt auf Hopelessness eine neue Form des Protests: den ironisch-hymnischen Elektropop-Song.
Ihr stärkstes Statement sind nicht die Texte, sondern der Sound, der so kaputt-heroisch klingt.
Es ist kaum auszuhalten. Die politisch inspirierte Musik fordert zum Dekodieren von Sound-Zeichen auf. Wir hören genauer hin, und das geht nur langsam.
Drone Bomb Me - by ANOHNI from nabil elderkin on Vimeo.
In der zweiten Form der Verlangsamung zerinnen Körper, Stimme und das Organische. Künstler*innen wie Holly Herndon, Aïsha Devi, Oneohtrix Point Never, Elysia Crampton und die eingangs skizzierten Amnesia Scanner behandeln ihre Tracks als Gemälde. Sie schleifen wahlweise kubische Sounds gegeneinander oder lassen flächige Sounds ineinanderfließen. Ihre Sound-Elemente sind gleichzeitig disparat und fluid, alienhaft und unkonkret.
Holly Herndon - Chorus [Official Video] from RVNG Intl. on Vimeo.
Ein „organischer“ Ursprung ist kaum mehr auszumachen, höchstens als absolute techno-maschinelle Verneinung alles Organischen.
Digitale Prozesse sind eine häufige Inspirationsquelle dieser Post-Internet-Performer*innen. Holly Herndon etwa abstrahiert im Video zu „Chorus“ die Welt als kaputte Internet-Textur. Das Video zeigt einen Schreibtisch mit Laptop. Seltsam schlierige Filter liegen über den schrägen Bildern, Büroartikel schweben in der Luft, bleiben stehen. Ein Computer mit Albträumen, so wirkt dieses Video. Die Musik ist schroff, abgehackt, kehrt aber immer wieder zu einem melodischen Grundgerüst zurück. Die Musik von Elysia Crampton oder Oneohtrix Point Never hingegen ist abgründiger als Herndons Browser-Balladen. Das liegt möglicherweise daran, dass sie nicht wie eine Vertonung virtueller Erotik klingt, sondern die absolute Entgrenzung des Menschen zu ihrem Sujet hat. Bei Oneohtrix Point Never sind die beiden HD-Bildschirme auf der Bühne ebenso wichtig wie die sich nur minimal bewegenden Musiker, die hinter aufgeklappten Koffern verschwinden und was auch immer kontrollieren. Im Vordergrund stehen keine Menschen, sondern das Diktum des Sounds, das in parabolischen Kaskaden und hyperkomplexen Ellipsen auf das Publikum niedergeschrammelt wird. Diese Maschinen-Musiker*innen sehen das Studio im Kraftwerk’schen Sinn als „Entbindungsstation für maschinelle Lebensformen“ (Kodwo Eshun). Im Namen eines (bei Kraftwerk noch: maschinellen) digitalen Prozesses verweigern sie sich dem Menschlichen. Sie arbeiten mit unendlichen virtuellen Systemen samt ihren Fehlern und ersinnen sonische, ästhetisch verlangsamte Fiktionen für eine bessere Zukunftslosigkeit.
3. Retromanie
Die dritte Strömung der Langsamkeit reagiert auf ein überhitztes kulturelles Feld, das viele Agent*innen der Popmusik als „die immer komplexer werdende Welt“ beschreiben. Leider folgt darauf oft die pessimistische Zukunftsprognose, in der wir als unmündige Individuen betrachtet werden, die sowieso nichts ändern können. Wir wollen das Feld lieber wie Ben Ratliffs Aphorismus „Every Song Ever“ begreifen: als zukunftsliebenden Möglichkeits-Modus.
Dennoch beuten rechtspopulistische Parteien in Europa diese Langsamkeit aus, um populärer zu werden. Sie schmücken den Unsinnspruch „Früher war alles besser“ aus und gaukeln so Sicherheit vor. In der Popmusik ist diese Nostalgieform als Retromania bekannt geworden. Der britischen Musikkritiker Simon Reynolds erfand den Begriff und schreibt in seinem gleichnamigen Buch, bei Retromanie handele es sich „um ein sehnsüchtiges Schmachten nach einer verlorenen, glücklichen Zeit“, um eine „kollektive Sehnsucht, nach einer glücklicheren, einfacheren und unschuldigeren Epoche“. Reynolds meint, wir leben in einem Zeitalter des „re“: re-issues, re-unions, re-makes. Alles ist bloß Kopie und schon mal dagewesen. 2012, als das Buch veröffentlicht wurde, wurde diese kulturpessimistische Diagnose als eine Bedrohung für Innovation gelesen.
Vier Jahre später haben sich Musiker*innen diese pop-apokalyptische Gruselgeschichte längst zu eigen gemacht und aus der Hybridität von eigentlich allem eine Lust am Spiel mit Zeichen und Formen entwickelt.
Retromanie folgt einem paradoxen Dualismus: die übersteigerte Lust am Vergangenen einerseits, andererseits die zukunftsgerichtete Verneinung dieser Lust durch Auflösung von Genres, Zeit und Herkunftserzählungen.
Nichtsdestotrotz gibt es immer noch retroaktive Rückbesinnungen auf das Gewohnte und Bekannte. Vor allem Rockmusik schwelgt in Erinnerungen an heile maskuline Muskelwelten. Eine wichtige Differenzierung: Nostalgie war in ihrer ursprünglichen Form eine nachvollziehbare pathologische Emotion – es gab Abhilfe: Heidi kehrt in die Berge zurück und sie wird wieder glücklich, nachdem sie bei Klara im formatierten Frankfurt vor Sehnsucht todkrank geworden war. Fatalerweise ist Nostalgie im modernen Sinne eine unheilbare Emotion. Reynolds meint, „das einzige Mittel dagegen wäre eine Zeitreise“. Reynolds argumentiert hier eindeutig zu zukunftspessimistisch. Und selbst wenn: Ist nicht gerade Pop heute mehr denn je in der Lage, Zeitreisen zu machen? Die Frage, ob „Future“ als Paradigma der Popmusik ausgedient hat und durch eine Deflation der Erwartungen ersetzt worden ist, sollte also mit einem zukunftsliebenden Nein beantwortet werden.